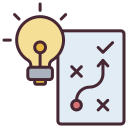Was-wäre-wenn-Szenarien für die Entwicklung smarter Städte
Die Planung und Realisierung smarter Städte steht im Zeichen sich rasch wandelnder Technologien, gesellschaftlicher Bedürfnisse und ökologischer Herausforderungen. Was-wäre-wenn-Szenarien sind ein kraftvolles Instrument, um potenzielle Entwicklungen, Chancen und Risiken in der Smart City Entwicklung vorausschauend zu durchdenken. Diese Form der Zukunftsbetrachtung ermöglicht es Stadtplanern, Politikern und Technologieunternehmen, agile und resiliente Konzepte zur Stadtgestaltung zu erarbeiten. Dabei spielen Datennutzung, Bürgerbeteiligung, Nachhaltigkeit sowie die Digitalisierung von Infrastrukturen eine zentrale Rolle. Im Folgenden werden vier Schlüsselszenarien vorgestellt, um die Dynamik und den möglichen Wandel smarter Städte besser zu verstehen und Innovationspfade zu identifizieren.
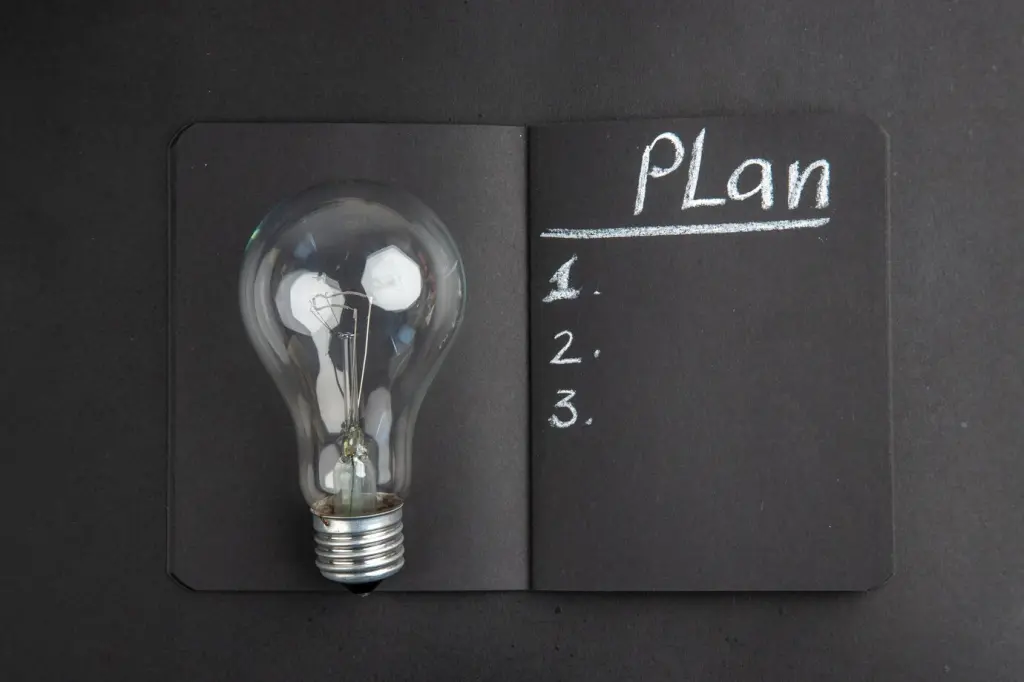
Vollständige Einführung autonomer Fahrzeuge

Digitalisierung des öffentlichen Nahverkehrs
Nachhaltige Energie und Ressourcenmanagement